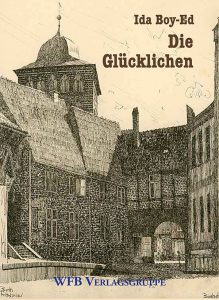
Ida Boy-Ed
»Die Glücklichen«
Roman
236 Seiten, Preis 14,95 €
ISBN 978-3-930730-20-9
I.
Es war um jene Zeit des Jahres, wo überall in Deutschland Manöver stattfanden. Auch in dem kleinen Winkel des Reichs, der sich aus hanseatisch-lübeckischem und mecklenburgischem Grund und Boden zusammensetzt und sich an dem südlichen Ufer der Travemündung hinzieht, gab es Divisionsmanöver. Von der alten Königin der Hansa, von Lübeck, bis zu dem Gestade der Ostsee herrschte das frohe Leben, das zahlreiche Einquartierung mit sich zu bringen pflegt. Die Nächte der großen Biwaks standen noch bevor; die Bevölkerung der Gegend erwartete sie, wie man eine Volksbelustigung erwartet. Aber die einzelnen Bataillone hatten da und dort ihre kleinen Vorpostenbiwaks, und auch an dem Abend des 1. September sah man auf einem weiten Stoppelfelde ein rühriges Leben.
Zwischen dem Felde und dem Fluß zog sich die Landstraße nach dem Mecklenburgischen hin. Die sinkende Sonne gab dem wolkenlosen Himmel und dem glattfließenden Stromspiegel einen gelbroten, metallischen Glanz. Der sich hinter der Kiefernschonung erhebende Laubwald begann zu düstern; das weiße Band der Landstraße, das aus ihm sich hervorschlängelte, zeigte sich zuweilen von Staub überwirbelt, dann rollte ein Wagen heran, der von Lübeck kam und nach Schlutup fuhr. Das Rollen der Räder ließ eine kleine Gruppe von Offizieren, die vor dem runden Bataillonszelt um einen Tisch saßen, jedesmal aufspringen und mit einer gewissen Enttäuschung sich wieder setzen.
»Allmer«, sagte ein junger Offizier zu einem Einjährig-Freiwilligen, der am Tische stand und sich ein Glas Wein eingoß, »deine Mutter kommt nicht mehr.«
»Ganz gewiß, lieber Schmettau, Beatrix wird schon dafür sorgen.«
»Im Grunde ist es auch viel verlangt, daß die Frau Gräfin zwei Stunden fahren soll, um uns zu besuchen, oder vielmehr, um Komtesse ein Biwak zu zeigen.«
Herr v. Schmettau sah nach der Uhr.
»Etwas nach sieben.«
In diesem Augenblick kam der Bursche des Herrn v. Schmettau über die Koppel dahergerannt. Ehe er seine Meldung ausgerichtet hatte, wußten die Herren ihren Inhalt schon, denn zugleich erschien vom Dorf her auf der Landstraße das Fuhrwerk der Gräfin Allmer. Die Offiziere – es waren ihrer vier an der Zahl – beeilten sich, dem Wagen entgegenzugehen. Das bräunliche Antlitz des Leutnants v. Schmettau überzog sich mit feinem Rot, seine braunen Augen leuchteten warm auf, als er, gleich den übrigen, schon von fern die Insassen des Wagens mit militärischen Grüßen willkommen hieß. Der junge Graf Allmer hielt sich ein wenig zurück. Hier im Biwak durften die militärischen Rangunterschiede doch nicht ganz außer Augen gelassen werden.
Die drei Damen dankten aus dem Wagen mit ruhiger Freundlichkeit. Dann hielten die vier Pferde mit einer kunstgerechten Plötzlichkeit, die der ganze Stolz des alten Wohlers, des ergrauten Familienkutschers des Hauses Allmer, war. Ehe jedoch der Diener vom Bock herunterkam, hatte der Major v. Beulwitz schon den Schlag geöffnet und reichte der Gräfin die Hand.
»Gräfin, welche Freude! Wollen Sie und die Damen gütigst den Zustand übersehen, in dem wir uns präsentieren müssen.«
Die Gräfin lächelte:
»Wie kann ein Offizier vorteilhafter erscheinen. Aber, Sie gestatten … liebe Dorothea, ich stelle dir hier Major von Beulwitz vor. Du weißt, er und sein Bruder Fritz waren die Gespielen meiner Kindheit. Fräulein von Allmer, eine Cousine meines Gatten, die jetzt bei uns auf Allmershof lebt.«
Der kleine dicke Major, dessen Gesicht von Zufriedenheit glänzte, verneigte sich vor den Damen. Die Gräfin war eine hochgewachsene Frau, deren schönes und stolzes Gesicht kaum von den vierzig Jahren sprach, die ihr doch die Gegenwart zweier erwachsener Kinder bezeugten. Ihr welliger, brauner Scheitel umkränzte eine glatte Stirn. Wenn sie lächelte, sah man schöne Zahnreihen. Die Farben ihrer Wangen waren frisch.
Fräulein v. Allmer, fünf Jahre jünger als die Gräfin, hatte trotzdem ein älteres Aussehen; ihre feinen Züge vertieften sich, sowie das Gesicht in Bewegung kam, bis zur Schärfe. Ihre schöne Gestalt hingegen bewegte sich mit vollendeter Sicherheit.
Beulwitz beeilte sich, seinen kleinen Stab vorzustellen. Der Hauptmann v. Santen und der Oberleutnant Lobedan verneigten sich ehrerbietigst, Schmettau als Freund des jungen Grafen bedurfte keiner Vorstellung.
»Aber wollen Komteß nicht aussteigen?« fragte der sehr blonde Leutnant Lobedan.
»Sieht das lustig aus!« rief Beatrix, von ihrem erhöhten Standpunkt das Bild militärischen Lebens betrachtend.
»Kommen Sie, in der Nähe ist es noch lustiger«, bat Schmettau. Ihre großen, dunklen Augen wanderten hin und her: sie streiften bald den einen Leutnant, bald den anderen, bald das Lager und liefen flüchtig über den Bruder hin.
»Schmettau – wie unausstehlich Sie mit der staubigen Feldmütze aussehen. Du, Botho, sei um Himmels willen mit dem Korb da vorsichtig, euer ganzes Frühstück für morgen früh ist darin. – Sie – Leutnant Lobedan! Wie sind Sie mit Botho zufrieden? Nicht wahr, ein Moltke geht nicht an ihm verloren?«
Sie reichte dem langen Leutnant beide Hände und sprang aus dem Wagen, wobei ihr die kleine Jockeimütze vom Haupt fiel und ihr knabenhaft kurzverschnittenes dunkles Haar zu sehen kam. Schmettau hob das Mützchen auf, sie pustete den Staub davon und setzte es sorglos, ob’s kleidsam oder unkleidsam saß, wieder aufs Haupt. Beatrix war kleiner als ihre Mutter, von ungemein zierlichem Wuchs und rastloser Beweglichkeit. Die sprühenden Augen paßten zu dem bräunlich-blassen Gesichtchen, in dem ein zierliches Näschen mit nervös-bewegten Flügeln sich ein wenig keck emporhob.
»Mit Ihrem Bruder, Komtesse, verlieren wir, wenn er gleich nach dem Manöver abgeht, den liebenswürdigsten Soldaten aus meiner Kompagnie. Vielleicht hebt es ihn in Ihren Augen, wenn ich Ihnen sage, daß er mit der Anwartschaft auf den Reserveoffizier entlassen wird.«
»Ich freue mich, daß er überhaupt entlassen wird. Bei uns ist es sterbenslangweilig. Und ich mag Botho im bunten Rock nicht leiden. Blonde Männer sollten nur bei Truppen mit blauen Aufschlägen dienen, der rote Kragen steht nicht zum hellen Haar. Ach ja so – pardon.«
Leutnant Lobedan war noch blonder als Botho. Aber die Herren lachten alle drei, am herzlichsten natürlich der dunkle Schmettau.
»Freuen Sie sich nicht, Schmettau«, rief Beatrix ebenfalls lachend, »deshalb sind Sie doch lange noch nicht gefährlich.«
Die jungen Nachzügler trafen vor dem Bataillonszelt ein, wo sich die Burschen unter der Leitung des gräflichen Dieners alsbald daran machten, einen improvisierten Abendtisch mit dem Inhalt der Körbe zu besetzen. Unfern des Tisches, in einem tiefen Loch, das man in den Boden gegraben, wurde ein Feuer entzündet; ein Feldkessel hing an einem angekohlten Holzstabe, der quer über dem Loch lag, mitten in den Flammen. Beatrix war außer sich vor Vergnügen.
»Mama«, sagte sie, »ich darf doch heißen Punsch mit trinken? Sonst ist das Vergnügen nur halb.«
»Beatrix«, sagte Botho leise zu seiner Schwester, »habt ihr heute Besuch gehabt?«
Sie sah ihn erstaunt an.
»Besuch? – Wer sollte zu uns kommen? – Der Pastor war da und hat mich zu Gevatter gebeten bei seinem siebenten Kinde.«
»Sonst niemand?« Er seufzte.
Beatrixens laute Antwort war von den beiden Offizieren vernommen worden.
»Um Gottes willen – sieben Kinder! Und einer von uns oder gar mehrere haben das Glück, übermorgen dahin in Quartier zu kommen«, rief Lobedan.
»Was sagen Sie, Herr Leutnant? Mama will, daß der arme Pastor keine Einquartierung bekommt, und übermorgen werden Sie und – ich glaube – noch sechs Offiziere bei uns einziehen. Dann muß Mama einen kleinen Ball improvisieren.«
»Herrlich – eine famose Idee!« rief Lobedan.
»Werdet ihr die Baronin Pantin einladen? Bestimme Mama dazu«, sprach Botho hastig.
»Die Pantin hat gar keinen Besuch gemacht«, antwortete Beatrix bedenklich, »und ich weiß sowieso nicht, ob Mama …«
»Komteßchen – meine Herren«, rief hier Beulwitz, »der Tisch ist fertig. Frau Gräfin bittet.« – Auf der von Damast überdeckten Tischplatte drängten sich Schüsseln, Gläser, Flaschen im engen Durcheinander. Die Gesellschaft fand auf Feldsesseln Platz, und als deren zwei fehlten, rückten Schmettau und Botho die Kiste der Kompagnie heran, um sich darauf zu setzen.
Die Schatten über dem Walde waren schwärzer geworden, mit der Dämmerung wehte es leise herab durch die Lüfte. Die Holzstöße wurden entzündet, mächtig lohten die Kienfeuer in gerader Flammensäule empor, umspielt und überwölkt von leichtem Rauch. In den Strohschütten verkrochen sich Soldaten; andere standen in Gruppen um vereinzelte Zivilisten, die gekommen waren, hier ihre Einquartierung von gestern zu besuchen und zu bewirten; um das offene Feuer der Husaren, die wegen ihres bevorstehenden nächtlichen Aufbruchs Strohschütten und Einfriedigung verschmäht hatten, sammelte sich die Jugend aus dem nahen Dorf. Die schweren und großen Körper der Pferde hoben sich in schwarzen Silhouetten von dem fahl und fahler werdenden Abendhimmel ab.
»Wie schön das ist«, sagte Beatrix begeistert. Die Gesellschaft war sehr mit dem Essen beschäftigt. Beulwitz erzählte, daß sie heute mittag, trotz eines kleinen Konservenvorrats, nichts genießen konnten. Gerade als man hätte abkochen wollen, sei der feindliche Vorposten so freundlich gewesen, sie zu überfallen.
Beatrix begriff nicht, wie man in einer so romantischen Umgebung von Hunger reden mochte; sie sprach es zwar nicht aus, aber Leutnant Lobedan zog sich ihre tiefe Verachtung zu, weil er sich sehr eingehend mit den Vorzügen einer kalten Rebhuhnpastete bekanntmachte. v. Schmettau hingegen legte Messer und Gabel hin und bemühte sich, eine halblaute Unterhaltung mit ihr anzufangen.
»Ja, ja, Fritz und ich waren wilde Kinder, wenngleich ich eine Ungebundenheit, wie Beatrix sie zu meinem steten Kummer zeigt, nicht besaß.« Dabei drohte die Gräfin mit dem Finger, und aus ihren sonst ein wenig kalten Augen brach ein Strahl von Liebe, ja von Anbetung zu ihrer Tochter, daß der Scheintadel nur schwer das mütterliche Entzücken verhüllte. »Und Sie sagen, Fritz sei so ruhig geworden?«
»Nicht ruhig, aber ernst und beherrscht. Das bringt seine Pflicht so mit sich – als Prinzenerzieher – was wollen Sie? Prinz Leopold ist wohl seiner Zucht jetzt, aber nicht seiner Begleitung entwachsen. Im Augenblick macht er mit dem Prinzen eine Reise an befreundete Höfe; auch ein Besuch des mecklenburgischen Hoflagers ist vorgesehen, dem eine Fahrt nach Kiel zur Besichtigung der dortigen Fortifikationen folgen soll«, erzählte Beulwitz.
»So streifte Ihr Bruder unsere Gegend? Wenn Sie ihm schreiben, erinnern Sie ihn doch daran, daß hier seine Jugendgespielin lebt. Auch Prinz Leopold macht es vielleicht Vergnügen, die wiederzusehen, die an seinem Tauftage ihn in die Arme seiner königlichen Patin legte. Ich war damals Hoffräulein bei der Mutter des Prinzen«, fügte sie für Dorothea hinzu.
»Wie ist mir denn?« rief diese lebhaft. »Eine Freundin aus Schwerin schrieb mir in diesen Tagen, daß man Ende August oder Anfang September den Prinzen Leopold dort erwarte.«
»Herrlich«, konnte hier endlich Beatrix einfallen, »dann träfe es am Ende, daß der Bruder vom Herrn Major mit dem Prinzen käme, wenn wir Einquartierung haben. Nicht wahr, Mama, dann gibst du rasch einen Ball, so einen riesig gemütlichen Manöverball, zu dem man noch am Tage vorher einladen kann.«
»Aber, Kind«, begann die Gräfin mit schwachem Widerstreben.
Beatrix sprang auf und fiel ihr um den Hals.
»Ich lasse dich nicht eher los, als bis du ja sagst«, rief sie.
»Dann sagte ich nie ja«, murmelte Lobedan, worauf Schmettau halblaut ihm zubrummte:
»Kolossal überflüssige Bemerkung.«
»Bitte, Gräfin« – »bitte, Mama«, beschworen nun auch Beulwitz und Botho.
»Wo sollen wir genug junge Damen herbekommen«, sagte die Gräfin, schon halb gewonnen. Ihrem stürmischen Kinde eine Bitte abzuschlagen, war ihr unmöglich.
»Oh«, rief Beatrix sich aufrichtend, »die Bülows und die Randaus – das sind schon fünf Töchter und zwei Mütter, oder wenigstens eine. Die Baronin Randau tanzt, wie du, Mama, nicht mit ihren Töchtern zusammen. Dann ist Dorothea da – du tanzest doch, Tante? Du hast ja einen Ruf als elegante Tänzerin gehabt, sagt Mama … dann bin ich da und die älteste Pastorentochter; auch die Pastors vom Nachbardorf haben zwei hübsche Pensionärinnen aus guter Familie, und zu allerletzt: lade die Pantin ein.«
Bothos junges Gesicht versteinerte sich in Spannung. Seine blauen Augen hingen am Munde der Mutter.
»Die Pantin?« fragte Beulwitz, »von den holsteinischen Pantins?«
»Ich weiß es nicht«, sagte die Gräfin mit Zurückhaltung. »Denken Sie: eine Viertelmeile vom Schlosse Allmershof liegt eine Villa, die sich vor zehn oder zwölf Jahren ein reicher Russe dort erbaute. Grund und Boden hatte er meinem Gatten für eine übergroße Summe förmlich abgezwungen. Der Mann ward seiner Laune bald überdrüssig. Er zog fort – und seitdem wird das Gebäude vermietet. Nur selten fand sich im Sommer jemand, der so viel Geld und Mühe an einen so einfachen Aufenthalt verschwendete. Aber wer die Villa nimmt, gilt von vornherein für einen Millionär in der Gegend. Nun plötzlich, nachdem die Villa ein Jahr leerstand, hat sie am Ausgang des Sommers eine Mieterin gefunden, die allem Anschein nach auch den Winter dort wohnen will.«
»Und das ist die Baronin Pantin?« fragte Schmettau.
»Die Baronin Pantin. Sie hat noch keinen Besuch gemacht. Man weiß nichts Bestimmtes von ihr; sie sei Witwe, heißt es; sie habe an allen Höfen Europas gelebt, sagt die Randau; sie sei gefährlich schön, aber jetzt demi passé. Ich habe im Gothaischen nachgesehen, da ist eine Lydia Pantin geborene Baroneß Sobodka aufgeführt – das könnte sie sein! Wohl aus irgendeinem jener ›romantischen‹ Länder gebürtig, dem Namen nach wenigstens. Kann ich eine so ›schwankende‹ Gestalt einladen?« scherzte die Gräfin.
»Wenn sie erst Besuch gemacht hat – weshalb nicht«, meinte der Major. »Ich habe von der Frau gehört. Sie ist weder aus Rumänien noch Serbien, sondern aus gutem deutschösterreichischen Hause. Ihr Mann gilt als verschollen. Man sagt, er sei bei einer asiatischen Forschungsreise von dem Pfeil eines Turkmenen hingestreckt. Die Baronin hat in der internationalen Gesellschaft, die in Nizza, Baden-Baden und so weiter verkehrt, wegen ihrer Schönheit und ihres Geldes, das sie nach dem Tode respektive der Entfernung ihres Gatten erbte, großen Ruf. Auch in Paris spielte sie eine Rolle. Doch kann ich Ihnen versichern, daß ich die Frau in der ersten Gesellschaft traf, und daß es notorisch ist, daß sie in Italien und Wien bei Hofe verkehrte. Auch in Berlin, wo sie bis vor kurzem lebte, hätte ihrer Einführung wohl kaum etwas im Wege gestanden, wenn sie selbst sich nicht so sehr zurückhielt.«
»Aus der großen Welt an unseren stillen Strand!« rief Fräulein Dorothea. »Welch ein Wechsel!«
»Vielleicht war die Baronin Pantin – müde«, bemerkte Hauptmann v. Santen.
Botho, der nicht zu wünschen schien, daß man die Dame noch eingehender besprach, sprang auf:
»Wollen wir einen Rundgang machen, Beatrix. Sieh, es ist ganz dunkel geworden, und vor neun Uhr müßt ihr uns verlassen. Das ist so Biwakordnung. Tante Dorothea, gehst du mit?« – »Beulwitz und ich bleiben sitzen«, sprach die Gräfin. »Anton kann abräumen; Schmettau, rufen Sie doch Ihren Burschen zur Hilfe.«
»Es ist kalt, Frau Gräfin«, mahnte der Major, während die beiden Damen mit den Offizieren sich zwischen den umherstehenden Soldatengruppen verloren. »Rücken wir unsere Sessel näher zum Feuer.«
So saßen sie denn, zu ihren Füßen die lodernde Flamme, über der vorhin der Feldkessel gehangen, und die Glut bestrahlte ihre Gesichter.
»Gräfin«, begann der Major nach einer Pause, »darf ich Ihnen sagen, daß es mich unendlich froh macht, Sie wiedergesehen und Sie so sichtlich in der Fülle eines stolzen Glückes gefunden zu haben? Wie lebhaft erinnere ich mich der Zeit, als Sie in die Welt geführt wurden und Fritz und ich mit der Vertraulichkeit großtaten, die zwischen uns und der jungen, so viel gefeierten Schönheit jenes Winters herrschte. Wir waren grüne Jungen, Sie behandelten uns … mit einer gewissen Leutseligkeit. Fritz und ich waren – jetzt darf ich’s ja gestehen – beide in Sie verliebt. Aber ehe der Student und der Fähnrich sich geeinigt hatten, wer zuerst mit einem Geständnis vorgehen solle, kam Graf Allmer und beraubte unseren kleinen Hof seiner schönsten Zier. Ich erinnere mich weiter, daß man damals davon sprach, der Graf sei zu alt für Sie, Sie würden nicht glücklich werden. Aber so konnte das Schicksal sich nicht selbst widersprechen, es konnte nicht ein Wesen mit allen Gaben und Ansprüchen ausstatten, glücklich zu machen und glücklich zu sein, um es nachher um seine Forderungen zu betrügen. Sie sind glücklich!«
»Ja«, sagte die Gräfin aus tiefem Herzen und reichte dem Jugendgenossen die Hand, »ich bin glücklich. Ich war jung, schön – arm. Der Name und der Reichtum – beides bot mir Graf Allmer – reizten mich, und ich habe es nie bereut. Mein Gatte und ich hatten die gleichen Daseinsbedürfnisse, in der Arbeit sowohl als im Vergnügen. Das ist für eine Ehe oft wichtiger und glückbringender als alle Liebesleidenschaft. Er starb früh – aber er ließ mir meine Kinder! Sie kennen beide! Muß ich Ihnen erst sagen, daß ich Ursache habe, ihrer froh und stolz zu sein? Ja, ich bin glücklich! Mein Dasein war reich an Frucht, reich an Glanz. Alles gedieh unter meinen Händen, mein Glück schien sich auf die Lieben meines Kreises zu übertragen. Niemals hat der Schatten eines Familienzwistes oder einer unedlen Leidenschaft über meinem Hause geruht. Was kann ich Besseres tun, als dankbar mein Glück erkennen und den Überfluß benutzen, auch in den Hütten der Armut Licht zu verbreiten.«
Der Major sah treuherzig in das stolze, von der Flamme bestrahlte Gesicht der Frau, die so freudig und doch im Ton der Dankbarkeit von ihrem Leben sprach. Er hatte eine gewisse unklare Empfindung, als ob in diesem Lebensbild dennoch einige Farben fehlten, aber er war viel zu einfach im Denken, um sich klarzumachen, welche, und noch viel weniger imstande, diese Empfindung in Worte umzusetzen.
»Mögen Beatrix und Botho Ihnen niemals Ihr Glück stören! Beatrix hat so was von einer Dynamitpatrone an sich«, sagte er lächelnd.
»Ja«, gab die Gräfin zu, »die Kleine ist aus Quecksilber und Feuer zusammengesetzt. Ein entzückendes Temperament. Es wird die Aufgabe ihres Gatten sein, es zu zügeln, und wenn ich nicht ganz blind bin, glaube ich, daß auch hier mir das Geschick eine Sorge abnahm, noch ehe ich sie fühlte.«
»Sie denken an Schmettau?« fragte der Major.
»Allerdings. Sie wissen, er hat seit seiner Kadettenzeit in Plön alle Ferien bei uns zugebracht, er kennt Beatrix auf und nieder, eine kleine Liebelei entspann sich schon vor zwei Jahren, als er zuerst als Leutnant bei uns erschien. Ich sagte Günther aber damals, daß Beatrix erst achtzehn Jahre alt sein müsse, ehe er mit seiner Werbung ihre Ruhe stören dürfe. Schmettau ist arm, aber aus alter Familie und ohne jeden Anhang, und anstatt eine Tochter fortzugeben, bekomme ich einen Sohn mehr, dessen Liebe ich sicher bin.«
»Ich wünsche Ihnen von Herzen Glück«, sagte Beulwitz. »Da erleben wir wohl noch im Manöver eine Verlobung?«
»Wer weiß?« meinte die Gräfin. »Jedenfalls ist es mein Wunsch, daß Schmettau nach dem Manöver, wenn auch Bothos Militärjahr zu Ende geht, einen vierwöchigen Urlaub nachsucht, zu dessen Bewilligung ich auf Ihre Protektion, lieber Beulwitz, rechne.«
Der Major verneigte sich zustimmend. Das Gespräch der beiden verbreitete sich nun über Botho, von dem die Mutter lächelnd meinte, daß er seine Sturm- und Drangjahre wohl hinter sich habe. Die zwei Jahre an der Berliner Universität und das Jahr in Waffen hätten ihm, wenigstens seinen enormen Ausgaben nach, in Fülle Gelegenheit zum Austoben gegeben. Das müsse auch so sein, sie habe ihn nie beschränkt, und hoffe nun, daß er sich mit Freuden dem landwirtschaftlichen Beruf hingeben werde.
Während so die Mutter mit dem Jugendfreund ihre Hoffnungen und Pläne besprach, wanderten die anderen langsam über das Feld. Lobedan und Schmettau suchten rechts und links Beatrix’ Aufmerksamkeit allein für sich zu gewinnen, Dorothea folgte mit Santen und Botho. Als aber eine Ordonnanz mit einer Meldung an den Hauptmann herantrat, rief Dorothea Lobedan zu sich.
»Geben Sie mir Ihren Arm, Beatrix«, flüsterte Schmettau, »ich kann Sie dann besser führen. Sie sind ja außerordentlich freundlich mit Lobedan, gefällt er Ihnen so gut?«
»Hören Sie«, kicherte Beatrix an seiner Schulter, »daß ein Leutnant dünne Beine hat, ist traditionell, aber der sieht ja aus wie ein Storch.«
»Wenn das Tante Dorothea hörte«, lachte Schmettau.
»Kind! Beatrix!« machte das junge Mädchen nachahmend in gedehntem Ton, »die Mama ist zu schwach, deine unpassenden Bemerkungen verdienen Rüge.«
»Mit dem Ball – das wird reizend«, sagte der Leutnant, ihren Arm an sich drückend, »und am reizendsten, wenn er gerade mit Ihrem achtzehnten Geburtstag zusammenträfe.«
»Ach, dann fängt das Leben an!« rief sie mit heißem Ausdruck. »Dann werde ich tanzen und reisen, und Mama muß im Winter mit mir nach Berlin. Ja, ich will mich amüsieren.
»Und Sie werden heiraten und alles mit einem geliebten Manne zusammen genießen«, fügte Schmettau mit bewegter Stimme hinzu.
»Nun, das käme sehr auf die Umstände an«, sagte sie bedenklich.
»Es müßte schon ein Mann sein, der in der großen Welt stände. Von einem Offizier mich in kleinen Garnisonen herumschleppen zu lassen, fiele mir nicht ein.«
»Beatrix!«
»Aber Komtesse gehen an allem achtlos vorüber!« rief hinter ihnen Lobedan. »Sehen Sie, wie die Kerls da beneidenswert schlafen.«
Sie standen und schauten auf die Soldaten herab, die sich so tief in dem Stroh verkrochen, daß man sie kaum sah.
»Muß Botho nachher auch dahinein?« fragte Dorothea.
»Allerdings. Aber beruhigen Sie sich, die ungeheure Ermüdung ersetzt allen Komfort – man schläft in seinem Bett nicht besser. Und einen Hunger hat man so im Biwak – Sie ahnen gar nicht, Komtesse, welche rettende Tat das Souper war«, setzte er hinzu.
Da fiel es Beatrix ein, daß Schmettau nichts gegessen hatte. Mitleidig und gerührt sprach sie:
»Und Sie haben fast nichts genossen.«
»Beruhigen Sie sich seinetwegen«, bemerkte Lobedan, »ich kenne ihn; wenn Sie abgefahren sein werden, macht er sich über die Reste her.«
Schmettau warf dem Kameraden einen wütenden Blick zu, die Damen lachten.
Botho hatte sich, sobald er die Tante mit Lobedan im Gespräch sah, dem der Chaussee entgegengesetzten Rande der Koppel zugewendet, wo ein schmaler Feldweg tiefer in das Gefilde der nun abgeernteten Saatenbreiten führte. Das äußerste der Feuer nach jener Seite überlohte nur einen winzigen Streifen dieses Weges. Kaum aber trat der junge Graf in den hellen Schein auf dem Wege, als sich im nahen Schatten etwas rührte. Ein leiser Ton, wie das Schnalzen einer Zunge, die ein Pferd antreiben will, wurde hörbar, dann ein Schnauben und der dumpfe Tritt von Pferdehufen im weichen Sand.
Botho tat einen Schritt vorwärts – da tauchte es auch schon vor seinem Auge auf: zwei Rosse, groß und dunkel in der gespenstischen Beleuchtung, das eine gelenkt von einem Weibe im schwarzen Reitkleid, das andere von einem Mann, an dessen Rock es von Tressen und Silberknöpfen aufblinkte. Der Mann wandte auf einen Blick der Dame sein Pferd sogleich zurück.
Botho trat mit hastigem Fuß so nahe an die Reiterin, daß seine Schulter die Flanken des Tieres streifte.
»Endlich«, flüsterte er, ihre Hand ergreifend. Sie neigte sich zu ihm.
»Mein lieber Freund«, sagte sie leise, aber der Tonfall ihrer Stimme umschmeichelte ihn doch.
»Hast du lange hier gewartet?«
»Nicht sehr. In deinem Briefe gabst du mir den Rat, unbefangen vom Kommandierenden die Erlaubnis zur Besichtigung des Biwaks zu erbitten. Ich glaube, ich kenne Beulwitz, aber ich wollte nicht. Ich sehe drüben am Feuer deine Mutter«, sprach sie.
»Geliebte, man erwartet auf Allmershof deinen Besuch. Ich bitte dich, fahre morgen vor! Mir zuliebe«, flehte Botho.
»Ich mag nicht«, sagte sie mit ihrer müden Stimme, in der ein kranker Ton mitzitterte, wie auf einem Instrument eine zerrissene Saite mitklirrt.
»Mir zuliebe, Lydia. Wieviel Stunden des Glücks raubst du uns sonst. Und meine Mutter muß dich ja kennenlernen.«
Er zerrte den weiten Reithandschuh von ihrer Hand und bedeckte die kalten, schmalen Finger mit Küssen.
»Still, man wird dich sehen.«
»O nein, dein Pferd verbirgt mich. Also ja, Lydia?«
»Nun denn – ja«, versprach sie. »Sehe ich dich morgen? Seit ihr eure Garnison verlassen habt – es sind über drei Wochen –, habe ich dich nicht gesehen.«
»Morgen ist der 2. September – Sedanfeier. – Ob ich da den Nachmittag frei habe, weiß ich nicht. Aber übermorgen kommen wir auf Allmershof in Quartier. Auch du wirst …«
»Ich bekomme zwei Offiziere und ein Dutzend Gemeine«, unterbrach sie ihn. »Wenn du dabei wärest!«
»Nein, Geliebte, man sorgt rücksichtsvoll dafür, daß ich bei Mama wohne. Still … Beatrix.«
Vom Rande der Koppel scholl ihr Lachen und ihr Ruf: »Mit wem spricht denn Botho da?«
Botho trat mit einer förmlichen Verbeugung zurück; die Baronin Pantin ritt langsam, und unmittelbar von ihrem Diener gefolgt, den Weg zum Dorfe hin.
»Wer war das?« fragte Beatrix neugierig.
»Es war die Baronin Pantin«, sagte Botho mit bedeckter Stimme. »Ich sah sie hier halten, um das Biwaktreiben zu übersehen. Ich trat hinzu, stellte mich vor, und als die Dame darauf sagte: ›Ah, der Sohn meiner Nachbarin‹, war es nicht schwer zu raten, wen ich vor mir hatte.«
In diesem Augenblick schmetterte ein Trompetensignal über das Biwak.
»Die Retraite«, rief Botho und sprang davon.
»Leider muß nun geschieden sein«, sagte Lobedan bedauernd und schritt so rasch dem Bataillonszelt zu, daß Fräulein Dorothea förmlich neben ihm herlief.
»Günther«, flüsterte Beatrix, ihre Wange beinahe an Schmettaus Schulter schmiegend, »sagen Sie – war das nicht eine kleine Lüge von Botho? Kennt er die Pantin wirklich nicht?«
Wenn sie ihn Günther anredete, fühlte Schmettau sich immer bewogen, ihr den Willen zu tun. Beatrix erwartete deshalb auch jetzt genaueste Auskunft von ihm. Statt dessen fragte er entgegen:
»Wo sollte Botho die Baronin wohl kennengelernt haben?«
»Nun, sie war doch in Berlin und Botho studierte dort. Und dann, als er nach Wandsbek ging, um sein Jahr abzudienen, ist sie auch in Hamburg gewesen; ich weiß es gewiß.«
»Deshalb braucht sie Botho doch immer noch nicht zu kennen. Mir hat er nie etwas von ihr gesagt, mein Ehrenwort darauf«, beteuerte Schmettau.
»Ach«, sagte sie enttäuscht.
Schmettau konnte sein Ehrenwort geben. Aber daß er einmal im Zimmer Bothos eine Photographie gesehen, die eine sehr schöne Frau darstellte, und daß auf diesem Bild die Worte gestanden hatten: »Deine Lydia; nimm sie wenigstens im Bilde«, das braucht er Beatrix nicht zu erzählen.
Als alle aufbruchfertig nebeneinander am Schlage der Equipage standen, drückte man sich die Hände, lachte und nahm mit ungezwungener Herzlichkeit voneinander Abschied. Dann kehrten die Offiziere ins Biwak zurück.
Günther v. Schmettau kroch mit seinem Hauptmann in das kleine spitzdachige Zelt, wo der Hauptmann sich auf dem Stroh niederlegte und bald friedlich schnarchte. Günther kauerte sich auf dem ihm verbliebenen Winkelchen zusammen. Durch einen Spalt im Zelt lugte er zum Himmel empor. Träumte mit wachen Augen von dem geliebten Mädchen, das sich vor den ›kleinen Garnisonen‹ fürchtete. Ach, in das rauschende Leben des Glanzes und Genusses konnte er kein Weib führen! Er hatte nichts zu bieten als sein ehrliches, mutiges, warmes Herz. Und aus dem Bewußtsein dieses Reichtums heraus fand er in der Hoffnungsseligkeit der Jugend den Glauben an die Zukunft.
Müdigkeit übermannte ihn, aber die unbequeme Lage machte ihn frösteln, auch fühlte er nach den großen Strapazen des Manövertages und nachdem er heute abend nichts gegessen, einen plötzlichen, unabweisbaren Hunger. Sein Blick fiel auf den Frühstückskorb, den die Gräfin für die Herren zurückgelassen; der stand an der Zeltwand und die trübe Stallaterne, die mitten im Zelt, dicht über dem schlafenden Hauptmann baumelte, beschien ihn freundlich. Günther konnte nicht widerstehen. Er kroch vorsichtig, um den Schläfer nicht zu stören, an den Korb, knisterte und tastete da eine Weile zwischen Papier und Servietten umher und zog die Hand mit einem appetitlichen Lachsbutterbrot wieder hervor. Eben biß er hinein, daß die weißen Zähne unter seinem dunklen Schnurrbart lustig aufblinkten, als zwei gekrümmte Zeigefinger den Spalt im Zelt von außen erweiterten und der lange Leutnant Lobedan seine hagere Nase hereinsteckte.
»Guten Appetit«, flüsterte er und lachte hell.
Günther ärgerte sich. Ohne Zweifel würde Lobedan erzählen, daß er ein guter Prophet gewesen. Er aß aber doch weiter und legte sich dann etwas ernüchtert und traumlos zum Schlafen nieder.
Botho, der sich dienstmäßig wieder in den Gefreiten Allmer der dritten Schwadron zurückverwandelt hatte, kroch ins Stroh, woselbst sein ›Putzkamerad‹ sich bemühte, ihm von Mantel und Pferdedecken ein gemütliches Lager zu bereiten.
Aber der junge Graf beachtete nicht, ob er bequem oder kalt läge. Den Ellenbogen aufstützend starrte er ins Feuer, an dessen Rand die Feuerwache neben dem Holzvorrat kauerte. Die prasselnde Glut streckte rastlos ihre Flammenarme zum Himmel empor. In der nächtlichen Stille hörte man die leisen Töne des Lebens im Lager. Zuweilen stampfte ein Pferd, oder ein Mann drehte sich raschelnd im Stroh herum; der eintönige Schritt der Wachtposten klang dumpf herüber, das glimmende Holz im Feuer knisterte und ließ Funken fallen.
Botho sah ungeblendet in die Flammen, aus denen sich ihm ein übermächtiges Geheimnis zu gestalten schien. Wie berauscht warf er sich endlich nieder und vergrub das blonde Haupt im Stroh.